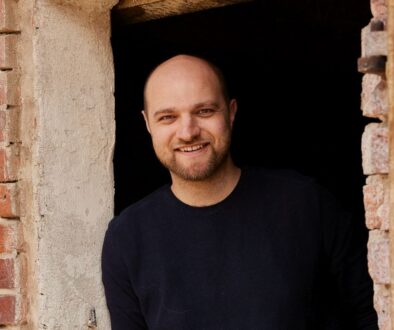Das stille Sterben
Während große Industriekonzerne ihre Marktmacht ausbauen, wird das deutsche Lebensmittelhandwerk von der Politik benachteiligt. Ein Gutachten der Heinrich-Böll-Stiftung hat das Marktversagen analysiert und fordert einen deutlichen Kurswechsel.
Es ist ein Sterben, das kaum jemand bemerkt – und doch betrifft es die Grundversorgung des Landes. Die Zahlen sind alarmierend: Seit 1998 hat Deutschland
- 60 Prozent seiner Mühlen,
- 57 Prozent der Bäckereien und
- 47 Prozent der Metzgereien verloren.
Insgesamt schrumpfte die Zahl der Lebensmittelhersteller in nur 20 Jahren um 44 Prozent. Fast die Hälfte existiert nicht mehr. Gleichzeitig wächst die Macht der Großen: Nur 795 Unternehmen – gerade einmal 3,2 Prozent des Sektors – erwirtschaften heute 83 Prozent des Branchenumsatzes. Und diese großen Player werden zunehmend selbst zu Herstellern. Die Schwarz-Gruppe, Mutterkonzern von Lidl und Kaufland, ist inzwischen das drittgrößte Verarbeitungsunternehmen des Landes. Auch Edeka betreibt Fleischfabriken und kauft Bäckereiketten mit hunderten Filialen.
Ernährungssystem wird krisenanfälliger
Das Handwerk gerät so zwischen die Fronten: Die einst vielfältige und regional verwurzelte Struktur wird von industriellen Kapazitäten überlagert. „Eine Aushöhlung des Handwerks“, heißt es im Gutachten, das von Nachhaltigkeitsforscher Prof. Arnim Wiek, Dr. David Sippler und Sophie Buckwitz erstellt wurde. Wiek zeigt sich erschrocken, wie still im Verborgenen sich der Strukturwandel vollzieht und betont, dass die Tragweite der laufenden Veränderungen gesellschaftlich kaum wahrgenommen werden.
Denn das Verschwinden des kleinere Lebensmittelverarbeiter bleibt nicht ohne Konsequenzen. Weniger mittelständische Betriebe bedeuten weniger regionale Spezialitäten und eine stärkere Abhängigkeit von wenigen Großstrukturen. Dadurch werde das Ernährungssystem „anfälliger für Störungen“ und die Versorgungssicherheit sei krisenanfälliger. Noch gravierender sind die Auswirkungen für ländliche Regionen. Mit jedem geschlossenen Handwerksbetrieb verschwinden Arbeitsplätze, Wertschöpfung und regionale Identität. Oft bricht eine ganze Kette weg – vom bäuerlichen Betrieb über die Mühle bis zur Backstube. Industrialisierte Großproduktion führt zu hohen Transportvolumina, intensiven Monokulturen und standardisierten Rohstoffen. Regionale Handwerksbetriebe hingegen verarbeiten häufiger lokale Zutaten und tragen so zur Biodiversität bei – ihr Verschwinden verstärkt ökologische Probleme weiter.
Machtmacht und Fehlsteuerung vernichten den Mittelstand
Die Studie nennt zwei zentrale Gründe für das Sterben der KMU-Betriebe. Zum einem kämpft der Mittelstand mit einem extremen Preisdruck. Während Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal steigen, können kleine Betriebe kaum mit den Preisen der industriellen Massenproduktion konkurrieren. Durch die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels wird dieser Druck weiter verstärkt.
Zum anderen leiden die mittelständischen Lebensmittelverarbeiter unter politischen Fehlsteuerungen. „Handwerksbetriebe werden strukturell benachteiligt“, so das Gutachten. Förderprogramme und Entlastungen sind oft so gestaltet, dass vor allem große Unternehmen profitieren. Auch die Regulierung orientiert sich an industriellen Maßstäben – für kleine und mittelständische Unternehmen sind die Auflagen damit unverhältnismäßig hoch.
Nachhaltigkeitsforscher Wiek diagnostiziert daher „ein klassisches Marktversagen“. Das Prinzip der reinen Kosteneffizienz als einziges Kriterium habe dazu geführt, dass der Mittelstand systematisch aus dem Markt gedrängt werden. Diesen Zustand dürfe man keinesfalls als Normalität hinnehmen. Wiek verweist auf aktuell noch etwa 9.000 Handwerksbäcker. Wenn die Politik nicht gegengesteuere, werde voraussichtlich die Hälfte ihren Betrieb aufgeben.
Forscher fordern Kurswechsel
Das Forscherteam fordert daher einen deutlichen Kurswechsel und gibt den politischen Entscheidern folgende Empfehlungen:
1. Think small first
Das eigentlich geltende EU-Prinzip, politische Maßnahmen zuerst auf kleine Betriebe abzustimmen, müsse endlich ernsthaft umgesetzt werden. Notwendig seien:
- spezifische, weniger aufwendige Standards für KMU,
- Förderprogramme, die nicht nur großen Industriebetrieben zugutekommen,
- restriktivere Anwendung des Kartellrechts bei Übernahmen im LEH und in der Verarbeitung.
2. Faire Marktbedingungen schaffen
Negative externe Effekte der industriellen Großproduktion – etwa ökologische Schäden – dürften nicht länger indirekt subventioniert werden. Preise müssten die wahren Kosten widerspiegeln.
3. Den Begriff Handwerk schützen
Industriebetriebe dürfen nicht länger mit handwerklichen Begriffen werben. Der Begriff „Handwerk“ ist in Deutschland nicht geschützt – ein Zustand, der laut der Studie dringend geändert werden müsse, um Verbraucher nicht weiter irrezuführen und echte Qualität sichtbar zu machen.
Die komplette Studie „Das Sterben des Lebensmittelhandwerks“ wird Ende 2025 von der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht.
Foto: fotolia/georgemuresan