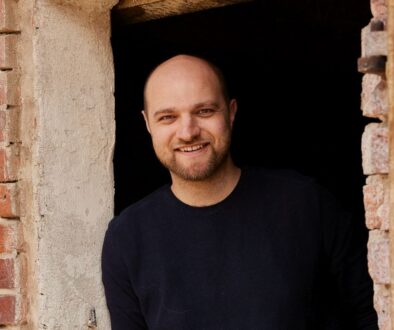Souveränität durch regionale Strukturen
In Zeiten globaler Krisen sichern regionale Wertschöpfungsketten unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Auf ihrem diesjährigen Bundestreffen diskutierte die Regionalbewegung, wie dieses Fundament unserer Ernährung für die Zukunft stabilisiert werden kann.
„Wir müssen es schaffen, dass wir regionale Strukturen erhalten – sonst haben wir in Zukunft kein Vermarktungsproblem für regionale Produkte, sondern ein extremes Verfügbarkeitsproblem. Wir alle müssen dieses Dilemma der wegbrechenden Strukturen gemeinsam angehen, egal ob bio oder konventionell, groß oder klein“, mahnte Nicole Nefzger, Geschäftsführerin der Regionalbewegung.
Die Zahlen zu regionalen Nahversorgungsstrukturen sind alarmierend: Zwischen 1998 und 2024 haben bundesweit rund 58 Prozent der Handwerksbäckereien und 46 Prozent der Fleischereien ihren Betrieb aufgegeben. Im selben Zeitraum hat sich die Anzahl kleinstrukturierter landwirtschaftlicher Betriebe (bis 50 ha) um 70 Prozent reduziert. Besonders dramatisch ist die Lage im Lebensmittelhandwerk, der Gastronomie und der regionalen Direktvermarktung. „Diese Entwicklung schwächt nicht nur die wirtschaftliche Substanz der ländlichen Räume, sondern gefährdet zunehmend die Versorgungssicherheit“, befürchtet Nefzger.

12. Bundestreffen der Regionalbewegung in der Lüngeburger Heide, Foto:Heinrich Helms
Rund 150 Teilnehmende, über 60 Referentinnen und Referenten trafen sich Mitte Juni zum 12. Bundestreffen der Regionalbewegung (BRB) in der Lüneburger Heide. Dort wurde intensiv darüber diskutiert, wie die rückläufige Entwicklung gestoppt werden kann. Gefordert wurde mehr Mut zur Regionalität, eine stärkere ressortübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie eine strukturelle Förderung für Nahversorger, Initiativen und kleine Erzeuger. Die Regionalbewegung sieht sich hier als Brückenbauer – über vermeintliche Gegensätze hinweg: zwischen konventionell und ökologisch, regenerativ und solidarisch wirtschaftenden Akteuren.
Durch Kooperation statt Spaltung, durch Nähe statt Anonymität könne Regionalität ihre volle gesellschaftliche Wirkung entfalten. Besonders Handel und Politik seien derzeit gefragt, um verbindliche Rahmenbedingungen für nachhaltige Strukturen zu schaffen und regionale Wertschöpfungsketten zu stärken, so das Fazit aus den Diskussionsrunden. Regionalität schaffe Vertrauen und Transparenz. Sie könne helfen, die Land- und Ernährungswirtschaft aus einer Krise zu führen, das Lebensmittelhandwerk zu (re)vitalisieren und Stadt-Land-Beziehungen zu stabilisieren. Nicht zuletzt leiste sie einen spürbaren Beitrag zu Biodiversität und Klimaschutz.
Das Netzwerktreffen hielt folgende Handlungsempfehlungen für die Politik fest:
Es gelte:
- regionale Wertschöpfungszentren aufzubauen,
- bestehende regionale Verarbeitungsbetriebe zu erhalten,
- eine ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen Agrar-, Umwelt-, Bildungs-, Wirtschafts- und Sozialministerium zu ermöglichen und
- die Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln einfach zu gestalten.
Der Regionalbewegung vereint insgesamt rund 360 Mitgliedsorganisationen, die sich aus verschiedenen Perspektiven für Regionalisierungs-Prozesse einsetzen. Dazu zählen Regionalinitiativen und regionale Vermarktungs-Initiativen ebenso wie Kommunen, Verbände und Startups sowie kleinste, kleine und mittelständische Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft.
Weitere Infos:
„